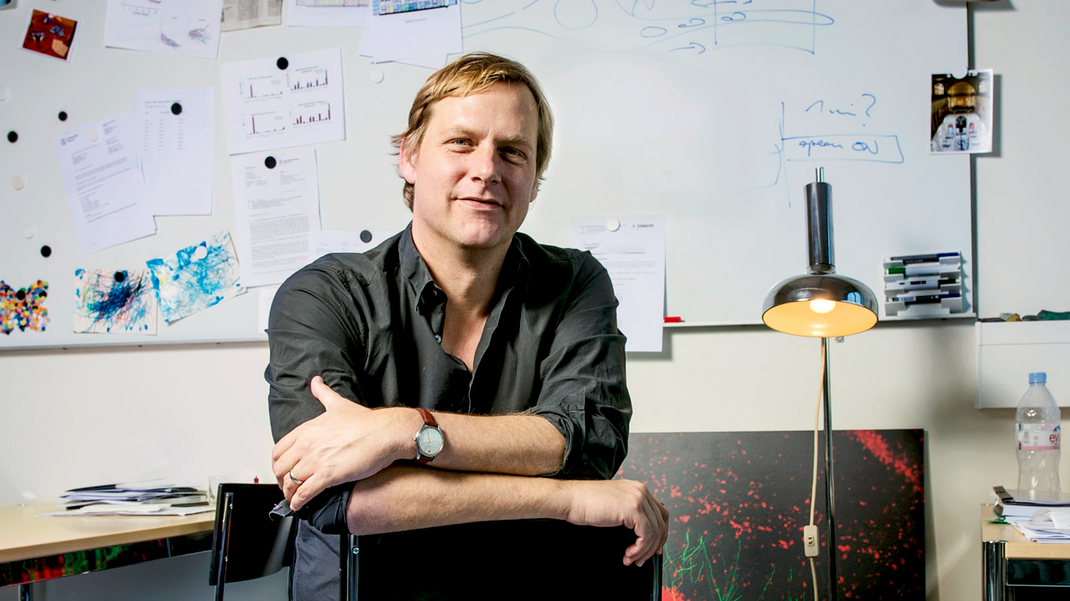Am Institut für Hirnforschung der Universität Zürich wird an den Grundlagen neurologischer Krankheiten geforscht. Möglich macht diese breit angelegte wissenschaftliche Arbeit ein grosszügiges Legat. Die Spenderin hatte sich dafür entschieden, ihr Herzensthema über das eigene Leben hinaus mitzugestalten. Sie hinterlässt damit Spuren, die langfristig wirken und die Hirnforschung nachhaltig stärken.
Ein Legat ist mehr als eine testamentarische Verfügung. Es ist eine bewusste Entscheidung, das weiterzugeben, was einem im Leben wichtig war: Werte, Überzeugungen und persönliche Anliegen. Auch die Universität Zürich (UZH) kann in einem Testament bedacht werden. Ein Legat zugunsten der UZH bedeutet, gezielt jene Themen zu fördern, die das eigene Leben begleitet und geprägt haben. Ob ein bestimmtes Fachgebiet unterstützen, jungen Menschen eine akademische Ausbildung ermöglichen oder die Wissenschaft insgesamt stärken – eine finanzielle Hinterlassenschaft für die Universität setzt ein Zeichen und führt persönliche Überzeugungen weiter.
Im vergangenen Jahr durfte das Institut für Hirnforschung der UZH ein besonders grosszügiges Legat entgegennehmen. Über einen Zeitraum von zehn Jahren ermöglicht diese Zuwendung die Förderung zahlreicher Forschungsprojekte in der Neurobiologie – etwa zu der Frage, wie Stresssymptome durch epigenetische Veränderungen weitervererbt werden können. Auch zu Erinnerungsvermögen, kognitiven Fähigkeiten oder neuronalen Besonderheiten wie Autismus wird durch das Legat aus neuen Perspektiven geforscht.
Ein Vermächtnis mit Wirkung
«Es ist eine grosse Freude, dieses Legat erhalten zu haben», sagt Professor Sebastian Jessberger, Direktor des Instituts für Hirnforschung. «Gleichzeitig ist es eine grosse Verpflichtung der Spenderin gegenüber, das Geld gemäss ihrem Wunsch einzusetzen.» Jessberger selbst untersucht in seiner Forschung, wie die lebenslange Neubildung von Nervenzellen durch Stammzellen funktioniert. Daraus können zum Beispiel neue Erkenntnisse zur Alzheimerkrankheit abgeleitet werden, bei der diese Neubildung eingeschränkt ist.
Die Vielfalt der mit dem Legat geförderten Forschungsvorhaben macht nicht nur die Bandbreite des Instituts sichtbar, sondern zeigt auch das Potenzial, das weiterhin in der Hirnforschung steckt. «Das Legat wurde mit dem Zweck gesprochen, die grundlegenden Funktionsmechanismen des Gehirns besser zu verstehen», erklärt Jessberger. Die pro Jahr geförderten Projekte zahlen alle auf dieses übergeordnete Ziel ein. Damit wird ein vertieftes Verständnis neurologischer Erkrankungen geschaffen und die Basis gelegt, um neue Therapieansätze zu entwickeln.
Um breite Forschungsfelder wie die Neurowissenschaften umfangreich zu erschliessen und Durchbrüche zu erlangen, sind Flexibilität und Innovation notwendig. Hier liegt die Besonderheit von Legaten: Sie ermöglichen es, neue und fortschrittliche Forschungsideen umzusetzen, die über
klassische Förderkanäle oft nur schwer finanzierbar sind. So leisten sie als zusätzliche Ressourcen einen wichtigen Beitrag dazu, grundlegenden Forschungsfragen nachgehen zu können.